Mit dem Auslaufen der KIM-Verordnung endeten gesetzliche Regelungen wie die Mindestanforderung von 20 % Eigenkapital, eine starre Kreditrate von maximal 40 % des Nettoeinkommens und die Maximal-Kreditlaufzeit von 35 Jahren. Institute bewerteten Bonität, Tragfähigkeit und Lebenssituation wieder individueller. Parallel entbrannte allerdings eine Diskussion um aufsichtliche Nachfolgeinstrumente.
Politik plädierte auf Kurs halten ohne „Hintertür“
In seinen Stellungnahmen argumentierte das Land Tirol konsistent: Bürokratie ab- statt aufbauen, Klarstellungen zu Zinsvereinbarungen und Zwischenfinanzierungen schaffen und keine KIM-ähnlichen Vorgaben ohne faktenbasierte Grundlage einführen. Gerade die geplante Verdichtung des Meldewesens in der VERA-V (Vermögens-, Erfolgs- und Risikoausweis-Verordnung) und die aufsichtsbehördliche Erwartungshaltung im Entwurf eines FMA-Rundschreibens wurden als widersprüchlich zum Regierungsprogramm kritisiert. Dieses habe die Erleichterung von Wohnungseigentum als prioritäres Ziel festgelegt. Die politische Leitlinie blieb: den Finanzierungskanal offenhalten, während mit Wohnbauförderung, Verfahrensbeschleunigungen und moderatem Dichten auf der Realisierungsseite nachgesteuert wird.

Nachwirkungen in der Praxis
Auch ohne gesetzliche Bindung bleibt die Aufforderung zur soliden Vergabe von privaten Wohnkrediten seitens der FMA. Somit gelten die bisherigen Vorgaben weiterhin als Richtwerte. Abweichungen bedürfen einer handfesten Begründung. Das bindet die Banken also weiterhin an strenge Kriterien. Dennoch: Die Nachfrage nach Wohnfinanzierungen hatte sich nach der Ankündigung und dem Auslaufen der KIM spürbar erholt. Das ist auch ein wichtiges Signal für junge Haushalte, die während der KIM-Phase trotz guter Perspektiven häufig abgelehnt worden waren. Gleichzeitig pochten Land und Banken auf klare Abgrenzung gegenüber einer „verlängerten KIM durch die Hintertür“, um den positiven Effekt nicht zu konterkarieren.
„Das Auslaufen der KIM-Verordnung war ein längst überfälliger Schritt. Die Regelung hat den Zugang zu Eigentum erschwert und wirtschaftliche Schäden verursacht.“
Patrick Weber, Landesinnungsmeister der Bauinnung Tirol

Was sich für private Haushalte konkret ändern sollte:
- Gestaltungsfreiheit in der Finanzierung
- Wegfall von Mindest-Eigenmittelquoten
- Anhebung der Kreditlaufzeiten
- Fokus auf das Gesamtbild des Kreditnehmers (Alter, Einkommen, vorhandenes Vermögen, Objektqualität)
- Rückkehr zum Einzelfallprinzip
Neue Flexibilität versus reale Umsetzung
Die KIM-Verordnung ist passé, doch die Realität am Markt bleibt differenziert. Viele Institute gewähren zwar wieder mehr Spielraum, orientieren sich intern aber weiterhin an bewährten Leitplanken etwa mit hausinternen Bandbreiten für Eigenmittel, vorsichtigen Schuldendienstquoten und strengeren Zins-Stresstests. Gleichzeitig diskutieren OeNB und FMA über zusätzliche Stabilitätsinstrumente wie z. B. Kapitalpuffer oder höhere Risikogewichte. Auch erweiterte Meldeanforderungen stehen im Raum. In Summe führt das dazu, dass die erhoffte Erleichterung in der Kreditpraxis nicht überall gleich stark ankommt.
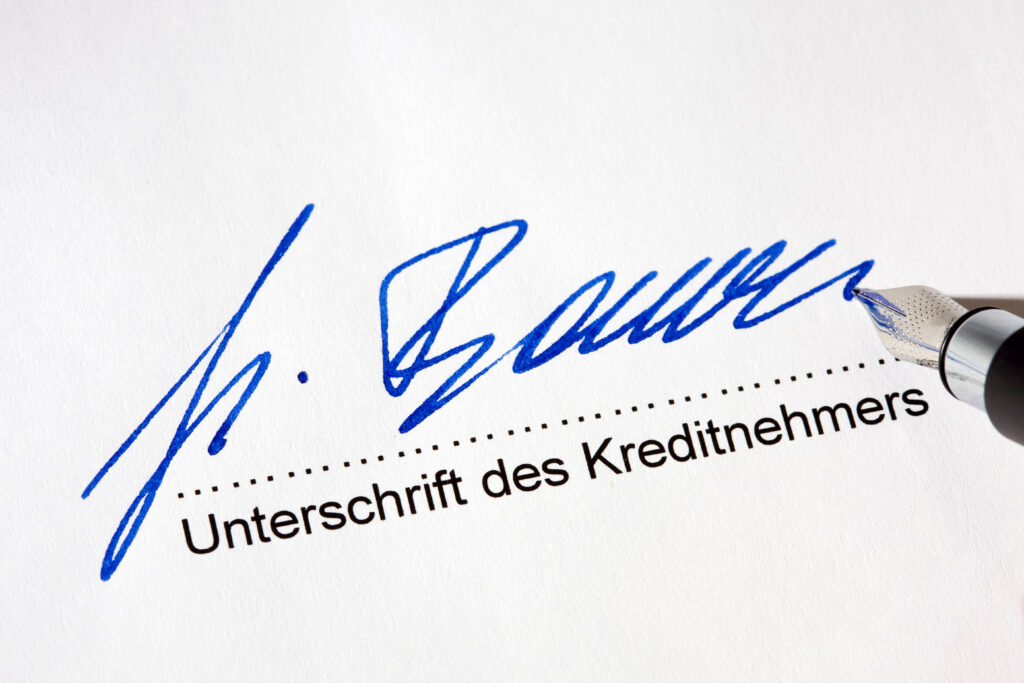
Fakten und Fazit
Der Zinsanstieg der vergangenen Jahre hatte die Leistbarkeit massiv belastet: Laut einer Studie der GAW (Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung) waren die monatlichen Kreditraten im Dreijahresvergleich um rund 55 % gestiegen. Bei gleicher Monatsbelastung ließ sich 22 % weniger Wohnfläche finanzieren. Das erklärt, warum die Bautätigkeit so stark eingebrochen war und warum der zusätzliche Finanzierungsspielraum seit Juli 2025 so wichtig wurde. Denn ein um ein Viertel schwächerer Wohnbau schlägt sich in Tirol mit nahezu 800 Millionen Euro weniger Betriebserlösen in der Bauwirtschaft sowie mit über 430 Millionen Euro geringeren Steuern und Abgaben nieder. Vor diesem Hintergrund warnte das Land nachdrücklich davor, KIM-ähnliche Regeln wieder einzuführen.










